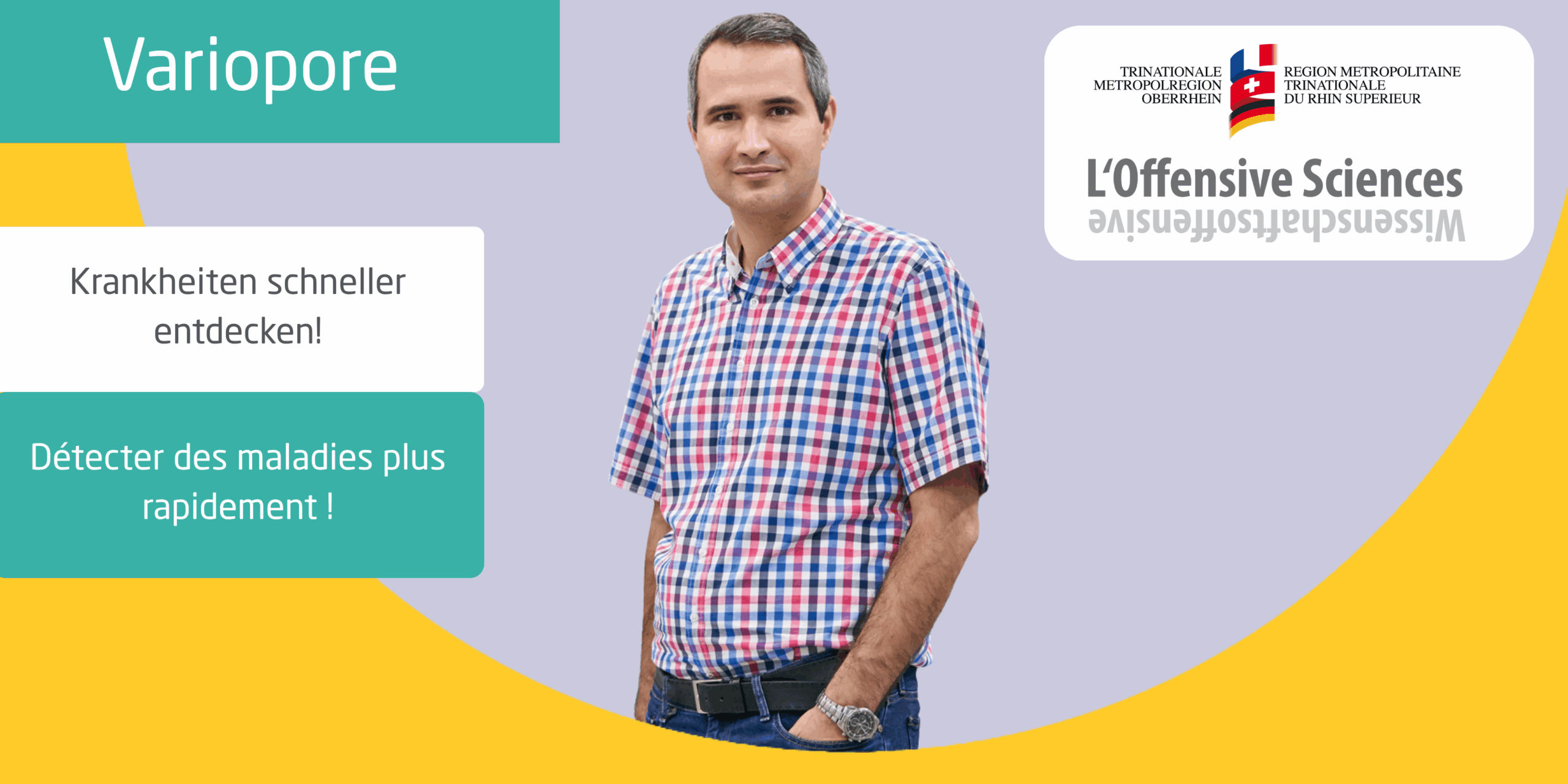Das Projekt VarioPore bringt eine Innovation in die Krankheitsdiagnose: Der Nachweis von Molekülen mit Hilfe eines Nanopores, um Schnelltests am Ort der Behandlung durchzuführen. Diese Innovation wird von einem trinationalen Konsortium entwickelt, bestehend aus der Hochschule Furtwangen, der Universität Haute-Alsace und der Fachhochschule Nordwestschweiz. Die Forscherinnen und Forscher arbeiten mit medizinischen und industriellen Partnern zusammen, um die bahnbrechende Technologie mobiler Diagnosegeräte für schnellere und zuverlässigere Tests am Ort der Behandlung, zu entwickeln und zu testen. Die Säule Wissenschaft hat sich mit dem Träger dieses im Rahmen der Wissenschaftsoffensive finanzierten Projekts unterhalten, der uns über die Entstehung des Projekts, die Expertise der Forschungsteams und die Fortschritte berichtet, die diese Technologie für Labore und Patienten bringen wird.

Können Sie sich kurz vorstellen und Ihre Rolle im VarioPore Projekt beschreiben?
Mein Name ist Bahman AZARHOUSHANG, ich bin Leiter des KSF – Institute for Advanced Manufacturing der Hochschule Furtwangen und wissenschaftlicher Koordinator des Projektes VarioPore.
Wie ist die Idee von VarioPore enstanden und was entwickeln Sie in diesem Projekt?
Die Idee kam ursprünglich während Corona-Pandemie auf. Zu der Zeit wurde klar, wie wichtig es ist, mögliche Erkrankungen schnell zu erkennen. Als wir von der Ausschreibung der Wissenschaftsoffensive erfahren haben, bot sich die Gelegenheit, eine schnelle und mobile Diagnosetechnik auf Basis von Nanoporen zu entwickeln. Die erste Anwendung sollte die Erkennung von Borreliose sein. Diese Krankheit wird von Zecken übertragen, was das Projekt für die Oberrheinregion besonders relevant macht.
Welche Technologie steckt hinter VarioPore?
Zuerst bringt man in ein Stück Keramik eine Vertiefung ein, so dass nur eine sehr dünne Schicht übrigbleibt, eine sogenannte Membran. Sie ist etwa so dick wie die Haut einer Seifenblase. In diese Membran wird ein extrem kleines Loch gebohrt. Der Durchmesser beträgt nur ein Tausendstel eines menschlichen Haares. Solche Löcher nennt man „Nanoporen“. Krankheitserreger wie Viren oder Bakterien können durch diese Nanoporen hindurch wandern. Legt man eine elektrische Spannung zwischen Ober- und Unterseite der Membran an, ergibt sich für jeden Krankheitserreger ein bestimmter Strom. Es entsteht quasi ein Fingerabdruck von jedem Virus und jeder Bakterie.
Bakterien und Viren können sehr unterschiedliche Größen haben. Die Durchmesser der Nanoporen müssen deshalb entsprechend gewählt werden. In diesem Projekt entwickeln wir eine Methode, mit der man die Größe der Nanoporen flexibel anpassen kann. Das macht die Untersuchungen mit dieser Methode nicht nur schnell, sondern auch kostengünstig. Man kann ein und dieselbe Nanopore zur Erkennung mehrerer Krankheitserreger benutzen.
Im Konsortium Ihres Projekts sind mehrere Hochschulpartner aus der Oberrheinregion beteiligt. Welche Kompetenzen bringt jede Einrichtung mit?
An der Hochschule Furtwangen (KSF) werden die Verfahren entwickelt, um die dünnen Membranen zu fertigen. Dazu wird ein Laser benutzt. Anschließend werden die Nanoporen in die Membranen gebohrt. Dafür gibt es zwei Methoden: Die erste nutzt quasi einen elektrischen Funken, um eine Nanopore zu erzeugen, die andere ein speziell dafür ausgerüstetes Elektronenmikroskop.
An der Fachhochschule Nordwestschweiz werden als Alternative dazu Membranen und große Nanoporen mit einem 3D-Druck-Verfahren erzeugt. Das hat Vorteil, dass nicht nur runde Nanoporen, sondern auch andere Formen wie beispielsweise Schlitze erzeugt werden können, was bei bestimmten Krankheitserregern Vorteile bei der Erkennung bringen könnte.
An der Université de Haute-Alsace werden spezielle Kunststoffe entwickelt, um damit die Oberflächen der Membranen und Nanoporen zu beschichten. So können unter anderem ihre elektrischen Eigenschaften angepasst werden.
Am Institute of Precision Medicine (IPM) der Hochschule Furtwangen laufen alle diese Entwicklungen zusammen. Dort entsteht das Diagnosegerät und finden auch die Tests statt.
Was ist für Sie der Vorteil, dieses Projekt mit Partnern aus der Grenzregion zu entwickeln, und umgekehrt, welchen Mehrwert bringt Ihr Projekt für den Oberrhein?
Ein klarer Vorteil ist, dass wir die richtigen Partner in der Nähe finden konnten. Alle bringen genau die passende wissenschaftliche Expertise, Erfahrungen und benötigte Ausrüstung in das Projekt ein. Die Zusammenarbeit bringt auch eine bessere Vernetzung mit sich. Das macht es einfacher, weitere gemeinsame Projekte anzustoßen. Außerdem ist es natürlich für Forscher und Forscherinnen immer interessant zu erfahren, wie an anderen Hochschulen geforscht wird.
Ziel des Projektes ist ja, eine schnelle und kostengünstige Methode zur Erkennung von Krankheiten zu entwickeln. Davon profitieren alle Menschen am Oberrhein, aber auch darüber hinaus. Das Projekt trägt durch eine bessere Vernetzung auch dazu bei, die Forschungszusammenarbeit am Oberrhein zu stärken. Das ist ein klarer Wettbewerbsvorteil, weil so mehr Innovationen geschaffen werden.
Das Projekt VarioPore ist ein Projekt der Wissenschaftsoffensive der Trinationalen Metropolregion Oberrhein, welche vom Interreg-Programm Oberrhein, der Région Grand Est, dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg und dem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz kofinanziert wird. Die Schweizerische Eidgenossenschaft und die Kantone der Nordwestschweiz beteiligen sich an der Finanzierung der Schweizer Projektpartner.
PWeitere Informationen zum Projekt: https://www.hs-furtwangen.de/forschung/forschungsprojekte/variopore